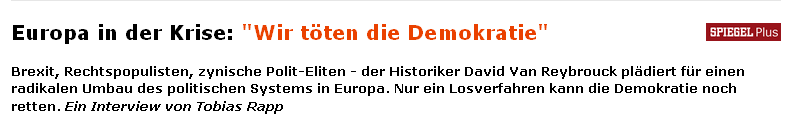
SPIEGEL-Teaser
Ist es schon eine journalistische Leistung, den Inhalt eines (quergelesenen) Buches kurz zu referieren und dem Werk noch eine Schulnote zu verpassen? Zumindest letzteres, die persönliche Bewertung, ist nutzlos, wenn der Rezensent den Weg zu seiner Meinungsbildung nicht nachvollziehbar macht. Dazu dürfte in der Regel auch gehören, das “Marktumfeld” des besprochenen Buches zu kennen und zu würdigen.
Mit offenbar großem PR-Aufwand ist es dem deutschen Wallstein Verlag gelungen, das bei ihm aus dem Niederländischen übersetzt erschienenen Buch “Gegen Wahlen – Warum Abstimmen nicht demokratisch ist” von David Van Reybrouck in den Medien zu lancieren. Noch vor dem Erscheinungstag brachte der SPIEGEL ein vierseitiges Interview mit dem Autor, zahlreiche Besprechungen gingen damit einher (u.a. im Deutschlandradio, der Welt, der Süddeutschen Zeitung, dem Tagesspiegel).
Allen journalistischen Beiträgen zu Van Reybroucks Buch ist gemein, dass sie kein Wort über das “Marktumfeld” verlieren, sprich: die schon lange laufende Fachdebatte um “aleatorische Demokratie”. Das mag man jemandem, der selbst seit zehn Jahren zu genau diesem Thema arbeitet und publiziert, als Erfolgsneid auslegen. Andererseits kann sachliche Mängel eigentlich nur erkennen, wer das Feld zumindest gut beobachtet – wenn nicht gar selbst bestellt.
Alle Rezensenten habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass Van Reybrouck zwar ein tolles Buch geschrieben hat, dass seine Idee der Auslosung statt Wahl aber nicht ganz neu ist. Nur ein(e) Autor(in) hat darauf reagiert – und schrieb mir:
>>Sie wissen, wie Aufträge vergeben werden: “Ganz wichtiges Buch, erscheint übermorgen, kannst du es rezensieren?” Es ist wirklich billig, “geringe Recherchetiefe” zu kritisieren, ohne zu fragen, welche Ressourcen Redaktionen und Autoren überhaupt haben. Ich zweifele nicht daran, dass ich mit etwas mehr Zeit auch mehr hätte in Erfahrung bringen können, und für Ihre Hinweise bin ich dankbar, aber wenn Sie mal gucken, worüber ich in den letzten Wochen geschrieben habe, werden Sie sich eher wundern, dass überhaupt “Recherchetiefe” da ist. […] Ich werde bestimmt [auch bei weiteren Rezensionen] nicht die gesamte Diskussion mit einbeziehen können – [und beim vorgegebenen maximalen Umfang meiner Rezension] würde es mir gar nicht nutzen, die gesamte Diskussion zu kennen. Ich bitte also um etwas mehr Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen derjenigen, deren Arbeit Sie beurteilen.<<
Sicherlich sind Rezensionen angesichts der notwendigen Arbeit schlecht bezahlt und Redakteure/ Redakteurinnen haben ihre Schreibtische voll mit Themen, die sie erledigen sollen. Aber ist das eine Rechtfertigung für unterbliebene Recherche?
Schon wenn man in Van Reyboucks Buch nur einigen seiner vielen Fußnoten folgt, muss man erkennen, dass da nicht ein Buch vom Berg Sinai kommt, sondern eingebettet ist in eine Literaturlandschaft. In seiner Bibliographie, die nicht einfach alphabetisch Buch- und Zeitschriftentitel listet, sondern deutlich gewichtet, was dem belgischen Autor bei der Entwicklung seiner eigenen Gedanken wichtig war, ist unübersehbar, wie ausführlich das “Losverfahren” als demokratisches Instrument bereits seit Jahren in Fachkreisen und vor allem im englischen Sprachraum diskutiert wird.
Natürlich kann ein Rezensent nicht all die angegebenen Literaturstellen lesen, aber er sollte einen Eindruck von Umfang und Tiefe des Themas bekommen. Zu den einfachsten Rechercheschritten sollte doch wohl gehören – wenn man sich im Thema noch nicht auskennt – einmal eine beliebige Internet-Suchmaschine mit dem Stichwort zu füttern. Und siehe da: es tauchen deutschsprachige Artikel auf, es gibt Wikipedia-Einträge (bei deren deutscher Variante sich für gewöhnlich bei solchen Großthemen ein Klick auf den entsprechenden englischen Eintrag lohnt), es gibt Literaturlisten, Hausarbeiten und vieles mehr. In der Schweiz läuft sogar eine Initiative für eine Volksabstimmung mit dem Ziel, die Nationalratsmitglieder auszulosen statt zu wählen.
Und wenn ich meiner Rezension einen Titel gebe, zumal wenn er so naheliegend ist wie “Losen statt Wählen” – sollte es doch Standard sein, diesen Titel einmal durch die Online-Suche zu jagen, wenigstens das. Es zeigt sich dann, dass es bereits mehrere Beiträge mit genau diesem Titel gibt – was zu der Annahme verleiten könnte, auch das eigene Thema könnte schon mal behandelt worden sein. Lohnt es da nicht wenigstens mal einen Blick auf die Kollegenbeiträge zu werfen?
Ich weiß nicht, was SPIEGEL-Redakteure den ganzen Tag so tun, wenn sie offenbar nicht an dem Thema recherchieren, mit dem sie endlich mal wieder im Blatt vertreten sein werden. Und Fragen in Interviews entsprechen natürlich keinesfalls der Ahnungslosigkeit des Fragestellers, schließlich unterhält man sich nicht unter vier Augen, sondern für ein Millionenpublikum. Deshalb darf man erwarten, dass ein SPIEGEL-Redakteur auf seine Frage
“Gibt es Beispiele, wo das Losverfahren in der europäischen Politik schon einmal funktioniert hat?”
natürlich längst die Antwort weiß, denn das ist ja wohl die erste Frage, die man sich als Journalist bei Reybroucks Buch stellt, wenn man nicht schon längst vom Fach ist. Doch der weitere Gesprächsverlauf lässt leider nicht erahnen, dass SPIEGEL-Redakteur Tobias Rapp wirklich schon die Antwort kannte, dass er sich wenigstens einige der vielen hundert Losverfahren in der Politik angeschaut hat, die es in der jüngsten Zeit gab. Und wenn er dann noch darauf insistiert, ausgeloste amerikanische Geschworenen-Jurys machten jeden Gerichtsprozess zu einem “Theaterstück”, dann hat Rapp offenbar wirklich keinen blassen Schimmer von den Bürgerjurys, die es u.a. in Deutschland seit vier Jahrzehnten gibt. Denn sonst hätte er Van Reybrouck nicht allein mit seinen erdachten Vorbehalten konfrontiert, sondern wäre auf konkrete Anwendungen eingegangen, etwa eine sehr umfangreiche des Landes Rheinland-Pfalz.
Nur weil jemand ein Buch geschrieben hat, muss er nicht weise sein. Wenn ein Autor wie Van Reybrouck allerdings für sein akribisches Arbeiten gefeiert wird, sollte sich ein journalistischer Gutachter, der ein über Jahre entwickeltes Buch nach vermutlich wenigen Stunden Lesens im Ergebnis für “zweifelhaft” und die zentrale Aussage für “etwas pausbackig” hält, wohl doch im Thema auskennen und dies zeigen, soll sein Text einen Wert haben. Denn ein unbegründetes “mir gefällt’s” oder “mir gefällt’s nicht” wäre da vollkommen belanglos – würde es nicht unberechtigterweise erheblich zur Rezeption des Werkes beitragen.
In völliger Ahnungslosigkeit des Themas wurde Van Reybroucks Buch “Gegen Wahlen” bislang von vielen Journalisten missbraucht, ihre eigene Meinung über den guten Stand der Dinge zu äußern – ohne aufklärerischen Mehrwert für die Leserinnen und Leser, denen man doch Orientierung geben will, um als Demokraten agieren zu können.
Updates:
Spiegel-Redakteur Tobias Rapp hat kurz per Twitter reagiert:
@Helgolaender Ein Gespräch ist keine Rezension. Weiß nicht, was Ihr Problem ist.
— Tobias Rapp (@Tobiasrapp1) 24. August 2016
Twitter ist kein geeigneter Kanal für diskursive Medienkritik. Daher hier noch etwas detaillierter Kritik am SPIEGEL-Interview (und Diskussion in den Kommentaren?):
- Das Interview beginnt schon mit der Aussage: “Sie machen nun einen radikalen Vorschlag: Das Losverfahren könne die Demokratie retten.” Die ist natürlich nicht falsch, aber es fehlt jede Einordnung, dass Van Reybrouck da nicht alleine mit einer neuen Idee um die Ecke gekommen ist, sondern dass er vielmehr zu einer recht großen, vor allem wachsenden Gruppe von Befürwortern aleatorischer Demokratie gehört. Reybrouck selbst benennt ja zahlreiche Vordenker.
- Ein Vorhalt der Art “Es gibt Stimmen, die sagen, dass man die schwierigen Fragen künftig den Fachleuten überlassen solle” ist für die Leser wenig hilfreich. Wer konkret spricht denn so – und mit welchem Eigeninteresse? Zudem setzen deliberative Verfahren ja gerade mehr als das derzeitige System auf die qualifizierte Beratung durch Fachleute: anders als Berufspolitiker sollen die ausgelosten Bürger nämlich nicht selbst tolle Ideen entwickeln, Gesetze schreiben und Programme entwickeln, sie sollen nur darüber befinden, was Fachleute vorschlagen. Deshalb ist der Begriff “Jury” sehr passend.
- Dann sagt Rapp in dem Interview: “Losverfahren klingt nach Lotterie, nach Willkür. Als würden politische Entscheidungen per Münzwurf herbeigeführt.” Das ist eine mindestens grob fahrlässige Irreführung – denn natürlich denken viele Leute, wenn Sie nur ein Stichwort hören oder nur eine Überschrift lesen, an ein zufälliges Zustandekommen von Entscheidungen. Als Leser Van Reybrouck’s Buch und Kenner des Themas weiß man aber als Interviewer, dass nur Menschen für Beratungsgremien ausgelost werden sollen, und dass dies gerade im gegensatz zu Wahlen zu Kontinuität statt Willkür führt. Natürlich gehe ich davon aus, dass dies auch Tobias Rapp gelesen und verstanden hat, ich halte eine solch irreführende Frage aber auch mit Blick auf das Unterhaltungsinteresse der Leser für schlechten Journalismus. Im Verlauf des Gesprächs wird diese falsche Annahme auch nicht mehr hinreichend korrigiert, es gibt kein Gespräch darüber, wie die ausgelosten Bürger arbeiten sollen.
- Rapp stellt die interessante Frage, warum sich denn das Losverfahren nicht durchgesetzt habe, wo es doch so eine lange Geschichte habe. Leider gibt Van Reybrouck darauf keine klare Antwort, ein Nachhaken unterbleibt (bzw. das Interview ist eben so zusammengeschnitten). Im Buch “Gegen Wahlen” steht eine Antwort (und in “Demokratie für Deutschland” gibt es ein ganzes Kapitel dazu…)
- Dann meint Rapp: “Demokratie ist langsam. Das muss so sein. Es müssen Kompromisse geschmiedet und viele Interessen berücksichtigt werden. Lebt die Idee der Losverfahren nicht auch von dem Wunsch, es möge einfache Entscheidungswege geben? Einfacher vielleicht, als gut ist?”
Wer sich Beratungen ausgeloster Bürgergremien anschaut wird zweifellos feststellen, dass diese in der Tat schneller arbeiten als das “elektoral-repräsentative Parteiensystem – aber dennoch zugleich auch gründlicher. Es werden dabei systematisch viel mehr unterschiedliche Interessen berücksichtigt (nicht nur die finanzstarker Lobbygruppen). Und am Ende gibt es eben keine halbherzigen Kompromisse, sondern Konsens. Das ist ja gerade der Grund, warum die Befürworter aleatorischer Demokratie am Desinteresse des Journalismus so verzweifeln – weil eben viele Probleme offenbar überhaupt nur so gelöst werden könnten. - Mit den bereits oben genannten Kritikpunkten (und im Detail könnte man weitere benennen) wirkt das Interview daher schlicht nicht sachgerecht für die bisher nicht alltägliche Chance, ein konkretes Losverfahren vorzustellen.